Wunder und Aberglaube heute
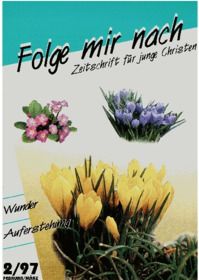
"Montag ist immer ein schlechter Tag", dachte Sebastian, denn montags hatte er Unterricht bei Herrn Kaminski. „Sag mal, bist du taub oder was?" rief plötzlich jemand. Er drehte sich um und stellte fest, daß Tim hinter ihm herlief, um - wie jeden Morgen - mit ihm zusammen zur Bushaltestelle zu gehen. Sebastian, ganz in Gedanken versunken, hatte die Stimme seines Freundes glatt überhört. „Wie kann es nur sein", dachte Tim, „daß er vergessen hat, auf mich zu warten?" Sie gingen schon seit dem ersten Schuljahr in die gleiche Klasse, hatten von dieser Zeit an vieles zusammen unternommen und in Freude und Leid zusammengehalten. So auch vorigen Sommer. Damals war Sebastian von Peter angestiftet worden, mit seinem Moped durch einen Bombenkrater zu fahren. Er war dabei gestürzt und hatte sich ein Bein gebrochen. Tim hatte ihn während der Zeit, die er im Bett verbringen mußte, oft besucht. Dabei hatten sie auch über Daniel gesprochen, dessen Leben damals in der Jugendstunde betrachtet wurde.
„TIM, STIMMT EIGENTLICH DAS, WAS IN DER BIBEL STEHT: ICH MEINE DIE WUNDER UND SO?"
Inzwischen war Tim nähergekommen und überschüttete Sebastian mit Fragen: „Wo warst du gestern? Wer war noch da? Hast du auch die Hausaufgaben nicht gemacht?" Sebastian, wie immer eher still und nachdenklich, ein zuverlässiger Freund und gewissenhafter Schüler, ging darauf gar nicht ein, sondern meinte, um Beiläufigkeit bemüht: „Tim, stimmt eigentlich das, was in der Bibel steht; ich meine die Wunder und so?"
Tim hatte sich ja inzwischen daran gewöhnt, daß Sebastian in letzter Zeit bei gemeinsamen Gesprächen hin und wieder mit den Gedanken abwesend war, doch woran das lag, war ihm rätselhaft.
Es war eine Kette von Ereignissen gewesen, die Sebastian in seine jetzige Lage gebracht hatten. Sebastian und Tim besuchten seit den Sommerferien die Klasse 11. In den vergangenen Jahren hatten sie mit Herrn Müller in ihrem Lieblingsfach Religion viel Freude gehabt. Als sie nun Herrn Kaminski bekamen, der neben Religion bei ihnen auch noch Deutsch unterrichten sollte, begannen jene Schwierigkeiten, die sich an diesem Wochenende dramatisch zugespitzt hatten. „Aufklärung", das gemeinsame Thema für Religion und Deutsch, hatte er schon in der ersten Deutschstunde genannt und dann an der Tafel alles das gesammelt, was die Schüler darüber wußten. In Sebastians Heft stand schließlich:
Aufklärung
Die Aufklärung ist eine gesamteuropäische Bewegung. Sie begann im 17./18. Jahrhundert, beeinflußte alle Lebensbereiche und leitete den Prozeß der Verweltlichung der modernen Welt ein.
Die Aufklärung möchte die Menschheit von Überlie-ferungen, Einrichtungen, Vereinbarungen und Normen, die sich nicht vernunftmäßig begründen lassen, befreien. Diese Unabhängigkeit hat eine Basis: Die eigene Vernunft des Menschen.
Die Aufklärer glauben an die Unabhängigkeit der menschlichen Vernunft. Sie ist die einzige und letzte Instanz, die über Methoden, Wahrheit und Irrtum jeder Erkenntnis entscheidet.
Die Auswirkung der Aufklärung hinsichtlich der Bibel bis heute ist die Auseinandersetzung zwischen Vernunft und Offenbarung.
Der Wahlspruch der Aufklärung ist: Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.
Nach dieser kurzen Einführung hatte es viele interessiert, sich mit dem Ursprung der Denkweise auseinanderzusetzen, die, wie Herr Kaminski erläuterte, für die moderne Welt von kaum zu überschätzender Bedeutung sei.
Neben der Schrift Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (1784) von Kant sollte in Deutsch im kommenden Schuljahr Lessings Nathan der Weise behandelt werden. Da in dieser Zeit auch die Anfänge der modernen Bibelkritik liegen, hatte es sich für Herrn Kaminski geradezu angeboten, deren Entwicklung bis heute an ausgewählten Beispielen parallel im Fach Religion zu erörtern.
Im Zusammenhang mit diesem Thema hatte er am Freitag morgen in Religion Kopien ausgeteilt, die bis Montag gelesen werden sollten. Die Aufgabe bestand darin, die Hauptaussagen des Textes zusammenzufassen.
Nachdem Sebastian sich bis zum Abend mit den Texten auseinandergesetzt hatte, war auf seinem Stichwortzettel folgendes zu lesen:
Die Bibelkritik
- Der Theologe Gerd Lüdemann sagt, die Bibel sei weder Gottes Wort noch Heilige Schrift, weil sie voller Irrtümer stecke. Er „hält nicht nur an den Erkenntnissen und Ergebnissen der Bibelkritik fest, die in 200 Jahren gewonnen wurden. Er will sie unters Volk bringen".
Die Arbeit moderner Ausleger wie Lüdemann gründet sich auf die Überzeugung, daß „Kein einziges Stück des Neuen Testaments von einem Augenzeugen verfaßt" sei.
Heute haben Bibelkritiker die meisten Lehrstühle für Neues Testament besetzt, und Theologiestudenten wird schon in den ersten Semestern vermittelt, daß bei weitem nicht alles so gewesen sei, wie es in den Evangelien steht.
- „Filtert man aus den Büchern der Neutestamentler die Ergebnisse ihrer Bibelkritik heraus, so lesen sie sich weithin wie ein Dementi der Berichte in den Evangelien: Jesus hat keine Wunder vollbracht und hat weder seinen Tod und seine Auferstehung noch die Zerstörung des Tempels angekündigt und auch sonst vieles nicht gesagt."
Das war Sebastian dann doch zuviel. Er verstand die Welt nicht mehr. Schon in der Sonntagsschule hatte er immer gehört, daß die Bibel Gottes Wort sei, vom Heiligen Geist inspiriert. Nun aber hatte er auf engem Raum das gelesen, was Herr Kaminski schon seit Beginn des Schuljahres versucht hatte zu vermitteln, nämlich daß man das, was in der Bibel steht, zuerst einmal anzweifeln müsse. Was man nun glauben konnte und was nicht, wußte er jedenfalls nicht mehr. Was sollte er nur machen?
Da lagen also Sebastians Probleme. Hatte Tim das doch früher gewußt! Um dies herauszufinden, brauchte er von Montag bis Donnerstag. Am Freitag in der Schule hatte er dann eine Idee. Er sagte zu Sebastian: „Sprich doch mal mit deinem Onkel Hanno über diese ganze Sache. Der kennt sich doch immer ganz gut aus."
Das tat Sebastian dann auch. Er rief seinen Onkel Hanno an, fragte, ob er am Samstag abend Zeit für ihn habe, und erläuterte kurz seine Probleme. Da Onkel Hanno sich schon seit längerer Zeit mit ähnlichen Fragen auseinandergesetzt hatte, war er froh, seinem Neffen helfen zu können, und sagte gerne zu.
Am nächsten Tag läutete Sebastian pünktlich um 19 Uhr bei seinem Onkel an der Haustür. Dessen Frau, Tante Sonja, öffnete, begrüßte ihn freundlich und fragte ihn, ob sie mit Anne und Wolf bei dem Gespräch dabei sein dürfte. Da Sebastian Tante Sonja als verständnisvolle Gesprächspartnerin schätzte und auch mit dem Cousin und der Cousine schon oft gute Unterhaltungen geführt hatte, erklärte er sich gerne einverstanden.
Nachdem sie es sich im Wohnzimmer bequem gemacht hatten und auch Onkel Hanno eingetroffen war, schilderte Sebastian seine am Telefon bereits angedeuteten Schwierigkeiten nochmals im Zusammenhang. Dann sagte sein Onkel, er habe nach Sebastians gestrigem Anruf etliches Material zu diesem Thema gesichtet und sich einige Notizen dazu gemacht. Deshalb schlage er vor, zuerst die Anfänge der modernen Bibelkritik in ihrer Entwicklung bis heute kurz zu erläutern. Die anderen willigten ein.
„Schon in der frühen Kirche", begann er, ,gab es immer wieder Gruppen, die das geoffenbarte Wort Gottes teilweise ablehnten oder sogar weitgehend leugneten. Dazu gehörten z.B. die sogenannten Doketisten, die abstritten, dals Christus je einen realen Körper oder eine genauer bestimmbare historische Existenz gehabt habe. Für die vormoderne westliche Welt, die für unsere Überlegungen besonders wichtig ist, gilt aber, daß die Zuverlässigkeit der Heiligen Schrift bis zum 18. Jahrhundert allgemein nicht angezweifelt wurde. Seit dieser Zeit verbreitete sich das Gedankengut der Aufklärung im gesamtgesellschaftlichen Denken immer mehr und siegte schließlich. Damit einhergehend nahm man zusehends Abstand von dem Glauben an die Inspiration der Bibel. Hermann Samuel Reimarus (1694-1768), Johann David Michaelis (1717-91) und David Friedrich Strauß (1808-74) gelten als die wichtigsten Vertreter der Bibelkritik seit der Aufklärung. Sie bezweifelten z.B. die Gottheit Christi oder stellten die in den Evangelien beschriebenen übernatürlichen Ereignisse als „Mythen" dar. Dies spiegelt sich auch in der Haltung der modernen Bibelkritik wider. Deren bekanntester Vertreter Rudolf Bultmann (1884-1976) war der einflußreichste Theologe des 20. Jahrhunderts und der berühmteste aller Bibelkritiker. Seiner Meinung nach kann man praktisch gar nichts über die Person und das Leben Jesu wissen. Die Evangelien seien alles andere als sichere Quellen.
Öffne meine Augen, damit ich Wunder schaue in deinem Gesetz! (Ps 119,18)
Wenn wir nun diese Entwicklung gut verstanden haben, können wir kurz über die heutige Bibelkritik reden. In manchen Zeitschriftenartikeln, aber auch in den vielen Büchern, die heutzutage das Christentum thematisieren, werden z.B. die vier Evangelien mehr oder weniger des Verrats beschuldigt, weil sie angeblich den wahren Jesus verbergen und diejenigen täuschen, die mehr über ihn erfahren wollen. Dabei wird sogar behauptet, die eigene Phantasie sei ein besserer Wegweiser auf der Suche nach dem historischen Jesus als die Evangelien. Diese Tendenzen müssen als eine der folgenreichsten Entwicklungen in der Geistesgeschichte des Abendlandes angesehen werden. Die Bibel war lange Zeit die Basis unserer Kultur. Auf ihr beruhen die Moralbegriffe der westlichen Welt sowie ihre Gesellschaftsordnung und wesentliche Teile der Bildung. Als der Papyrologe Carsten Peter Thiede kürzlich in einer Arbeit behauptete, daß das Matthäus-Evangelium vor dem Wendepunkt des Jahres 70 geschrieben worden sei, rief das einen Sturm des Protests von Wissenschaftlern hervor, die in der Tradition der Bibelkritik stehen, denn wenn dies zuträfe, gäbe es Konsequenzen: Die Schriftstücke hätten von Augenzeugen gelesen werden können. Eine Verfälschung der Tatsachen wäre dann also nahezu unmöglich gewesen, da dies sofort aufgefallen wäre. Des weiteren wären die prophetischen Worte Jesu bezüglich der Zerstörung des Tempels, die im Jahre 70 n. Chr. eintrat, nicht im nachhinein hinzugefügt, sondern wirkliche Prophetie. Thiede ist der Meinung, daß 200 Jahre Bibelkritik als einer der größten Irrtümer der Geistesgeschichte ausgelöscht werden müssen.
So, jetzt habe ich aber wirklich genug gerdet. Habt ihr alles verstanden, oder soll ich nochmal irgendwas weiter ausführen?"
„Du hast Reimarus erwähnt", sagte Sebastian. „Weißt du vielleicht, was der mit Lessing zu tun hat? Wir behandeln in Deutsch nämlich gerade das Stück Nathan der Weise. Ich meine, in diesem Zusammenhang hätte ich den Namen schon mal gehört."
Lessing und Goethe
„Tja, die Zusammenhänge mit Nathan dem Weisen weiß ich leider nicht mehr so genau", antwortete Onkel Hanno, „aber Anne - wenn ich nicht irre, hattest du im letzten Semester ein Seminar über Lessings Dramen. Vielleicht fällt dir dazu noch was ein."
„Wartet bitte einen Moment", entgegnete diese, „ich müßte oben in meinem Ordner noch ein Thesenpapier zu diesem Thema haben." Nach kurzer Zeit kam sie mit einem Zettel in der Hand zurück und begann vorzulesen:
„Als Lessing Bibliothekar in Wolfenbüttel war, hatte er von den Kindern des verstorbenen Hamburger Orientalisten Reimarus Teile von dessen Schriften erhalten, die er unter dem Titel Fragmente eines Ungenannten veröffentlichte und durch eigene Kommentare ergänzte. Die letzten Fragmente hatten den Titel Ein Mehreres aus den Papieren des Ungenannten, die Offenbarung betreffend. Diese entfesselten einen theologischen Streit, in dem sich der Hamburger Hauptpastor Johann Melchior Goeze als Lessings härtester Gegner herausstellte. Das Manuskript von Reimarus spiegelt den Angelpunkt der theologischen Kontroverse des 18. Jahrhunderts wider: Es ist der Gegensatz von emanzipierter Vernunft und Glauben, der sich im absoluten Wahrheitsanspruch der christlichen Offenbarung manifestiert. Die protestantischen Theologen, die sich dem Zeitgeist anpaßten, versuchten Vernunft und Glauben durch die Preisgabe dogmatischer Positionen zu versöhnen. Demgegenüber verteidigte die orthodoxe Theologie das geoffenbarte Wort der Heiligen Schrift kompromißlos. Reimarus Hauptkritik betraf sowohl den Offenbarungscharakter der Bibel als auch die Glaubwürdigkeit der Evangelien. So behauptete er z.B., daß die Jünger den Leib Jesu gestohlen hätten. Der aus den Veröffentlichungen entstandene ,Fragmentenstreit' zwischen Lessing und Goeze endete damit, daß Lessing im Juli 1778 durch einen Kabinettsbefehl verboten wurde, weitere Fragmente zu publizieren. Um dieses Verbot zu umgehen, schrieb er das Schauspiel Nathan der Weise, das bereits 1779 im Druck erschien.
Soweit dieses. Hier stehen aber noch einige Informationen, die Lessings Weltanschauung verdeutlichen:
Lessing veröffentlichte bereits 1753 eine Schrift, in der eine Person die Vernunft des Islam lobt und am Christentum unter anderem den Wunderglauben kritisiert. Der Islam stimmt nach Lessings Meinung dagegen mit der 'allerstrengsten Vernunft' überein, was zur Folge habe, daß der Mensch als Vernunftswesen nicht anders könne, als den Islam als vernünftige Religion anzuerkennen.
Was Lessings Suche nach Wahrheit betrifft, so war er mehr an dem (vermeintlichen) Weg dorthin interessiert als an der Wahrheit selber. Goethe vergleicht Lessings Wahrheitssuche mit der Methode der Muslime, die auf die Behauptung zurückgeht, es gebe mehr als eine Wahrheit. Dies ist auch unter anderem die Botschaft des Dramas Nathan der Weise. Daneben liefert die Tatsache, daß Lessing die Christen in dem Stück sehr schlecht wegkommen läßt, ein weiteres Indiz dafür, daß Nathan der Weise ein pro-islamisches Stück ist."
„Danke dir", sagte Onkel Hanno. „Weil du eben Goethe angesprochen hast, möchte ich noch darauf hinweisen, daß er wegen seiner Vernetzung von westlichem und östlichem Denken als einer der einflußreichsten Vorläufer des New-Age-Denkens gilt. Seine Vorliebe für östliche Religiösität zeigt sich hauptsächlich in seinem Werk West-östlicher Divan, aber auch in seinen Gesprächen mit Eckermann. Dort behauptet er, in uns allen sei etwas vom muslimischen Glauben, selbst wenn er uns nicht gelehrt worden sei. Auch lobt er, daß die Muslime zuerst einmal zum Zweifeln angeleitet würden. Dadurch werde der Geist zu weiteren Untersuchungen getrieben. Wenn dies auf die vollkommene Weise geschehe, gehe daraus die Gewißheit hervor. Diese sei dann das Ziel, worin der Mensch seine völlige Beruhigung finde.
Das war vielleicht ein bißchen kompliziert. Deshalb versuche ich noch einmal die wichtigsten Gedanken von eben zusammenzufassen: Lessing versucht in dem Stück Nathan der Weise zu vermitteln, daß nicht die Offenbarung Gottes in Jesus Christus die Wahrheit ist, sondern daß das Ergebnis eigener Anstrengungen die Wahrheit verschiedener Religionen erweise. Goethe meint, durch Zweifeln zur Gewißheit zu gelangen und dann innere Ruhe zu finden.
Ich möchte euch ausdrücklich auffordern, wenn ihr Schriften von diesen Autoren lest, aufzupassen, daß ihr nicht von ihrer Weltsicht beeinflußt werdet! Die Bibel sagt zum einen, daß die Wahrheit nicht bei vielen Religionen und eigenen, auf die menschliche Vernunft gestützten Aktivitäten zu finden ist, sondern nur in der Person des Herrn Jesus. Dies können wir aber nicht durch Zweifeln erfassen, sondern 'durch Glauben verstehen wir', wie in Hebräer 11,3 steht. Lessings größtes Problem in bezug auf die Bibel war also, daß er versuchte, die Wunder mit seinem eigenen Verstand zu erfassen. Daran scheiterte er schließlich, und mit ihm viele Schriftsteller und Philosophen.
Damit keine Mißverständnisse entstehen, möchte ich noch verdeutlichen, daß Verstand oder auch Intelligenz Eigenschaften sind, die wir von Gott empfangen haben. Ohne sie könnten wir weder denken noch handeln. Wo diese ihren Ursprung haben, wird in Hiob 32,8 deutlich. Dort steht: 'Jedoch der Geist ist es in den Menschen, und der Odem des Allmächtigen, der sie verständig macht.' Wir müssen auch Sprüche 9,10 bedenken: 'Die Furcht des HERRN ist der Weisheit An-fang; und die Erkenntnis des Heiligen ist Verstand.
Der Herr Jesus sagt in Johannes 14,26: 'Der Sachwalter aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe.' Dies ist somit die Basis dafür, daß wir, die Gläubigen, gottgemals verstehen können und daß die Ungläubigen dazu nicht in der Lage sind.
Ich wäre jetzt dafür, daß wir uns die wesentlichen Informationen aus unseren beiden kurzen Referaten noch einmal vergegenwärtigen."
Daran beteiligten sich alle. Sie kamen zu dem Ergebnis, daß sich die ganze Problematik auf folgende wenige Grundgedanken reduzieren lasse:
Die Aufklärung hatte zur Folge, daß sich die eigene Vernunft als Maßstab für die Beurteilung der Bibel etablierte. Seit dieser Zeit lassen sich die Menschen, die sich mit der Bibel beschäftigen, grob in drei Gruppen einteilen:
- Diejenigen, die die Bibel als Wort Gottes betrachten und alles für wahr halten, was darin steht.
- Diejenigen, die durch die Bibelkritik verunsichert sind und nicht wissen, was sie glauben können und was nicht.
- Diejenigen, die (wie Lüdemann) fundamentale Wahrheiten der Bibel leugnen und die eigene Vernunft zum Richter darüber erheben, was richtig und was falsch ist.
Der Geist ist es, der lebendig macht; das Fleisch nützt nichts. (Joh 6,63)
Der Teufel
„Wo kommt diese Haltung denn überhaupt her, daß Menschen Richter über die Bibel sein wollen?" fragte Wolf, kaum daß der letzte Punkt besprochen war.
„Dazu fällt mir was ein", sagte Sebastian, der allmählich auftaute, da er langsam die Zusammenhänge zu verstehen begann. „Als wir in der Jugendstunde über Daniel sprachen, haben wir uns gefragt, woher überhaupt das Böse kam, das die Juden veranlaßte, von ihrem Gott abzufallen, so daß sie schließlich in die babylonische Gefangenschaft gehen mußten, und warum Babylonien vom Götzendienst durchdrungen war."
„Kannst du uns nicht mal kurz erzählen, was ihr herausgefunden habt?" forderte Tante Sonja ihn auf.
„Das geht nicht, das meiste habe ich vergessen."
„Meine Güte", meinte Wolf, „das ist doch egal. Wenn dir nichts mehr einfällt, kann ja jeder das sagen, was er dazu weiß."
Sebastian fand, dies sei eine gute Idee, und begann:
„Soweit ich mich noch erinnern kann, sagte jemand, daß die ursprüngliche Bedeutung von Teufel 'Verleumder', 'Entzweier' ist. Satan bedeutet eher der Teufel als Feind Gottes und der Menschen schlechthin. Der Teufel wird in der Offenbarung 'der große Drache' und 'die alte Schlange' genannt. An anderen Stellen wird von ihm gesagt, daß er zum einen die Gestalt eines Engels des Lichts annehmen kann und zum anderen wie ein brüllender Löwe umhergeht. Das bedeutet konkret: Verführung durch List (wie beispielsweise im Garten Eden als Schlange) oder der Versuch, Menschen durch Gewalt und andere Dinge direkt zu schaden, wie beispielsweise bei Hiob. Dort sehen wir aber auch, daß der Satan nur so weit gehen kann, wie Gott - der jeden einzelnen kennt - es zuläßt."
„Stopp mal kurz", sagte Wolf. „Ich möchte mal zwei Bibelstellen vorlesen, die zeigen, wie es überhaupt dazu kam, daß der Teufel der Feind Gottes und böse wurde. Zuerst Jesaja 14,13.15. Dort wird von ihm gesagt:
"Und du, du sprachst in deinem Herzen: „Zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will hinauffahren auf Wolkenhöhen, mich gleichmachen dem Höchsten" Sein Verderben war also, daß er sich selbst in den Mittelpunkt stellte und sich eine Stellung anmaßen wollte, die ihm nicht zustand, nämlich zu sein wie Gott. Das Urteil Gottes darüber finden wir in Hesekiel 28,17.18. Dort sagt Gott: 'Dein Herz hat sich erhoben ob deiner Schönheit, du hast deine Weisheit zunichte gemacht wegen deines Glanzes; ich habe dich zu Boden geworfen, habe dich vor Königen dahingegeben, damit sie ihre Lust an dir sehen. Durch die Menge deiner Missetaten, in der Ungerechtigkeit deines Handels, hast du deine Heiligtümer entweiht; darum habe ich aus deinem Innern ein Feuer ausgehen lassen, welches dich verzehrt hat'"
„Gut", sagte darauf Onkel Hanno, wir können also festhalten, daß der Satan, als er erschaffen wurde, sündlos war. Er befand sich in der Nähe Gottes. Wegen seines Hochmuts und seiner Auflehnung gegen Gott wurde er verstoßen.
Ich möchte jetzt zur Verdeutlichung seines Wirkens in der heutigen Zeit etwas vorlesen, was ein Berliner Soziologe Ende 1993 über die Wiederkehr des Bösen heute gesagt hat: Wahr ist: Es gibt eine Entstrukturierung nicht nur des Bösen, sondern auch der gesamten Gesellschaft. Und das Böse ist damit wörtlich, wenn Sie so wollen, „entfesselt", ist überall und nirgends mehr lokalisierbar und mit Erklärungsmodellen, ob nun psychisch, sozial oder politisch gedacht, nicht mehr zu greifen. Das Gute ist abgeschlafft. Der Reiz, gut zu sein, ist dahin.
Die Aussage, daß das Böse nicht mehr lokalisierbar sei, ist vielleicht ein bißchen unverständlich. Um den Zusammenhang zu erklären, muß ich ein wenig ausholen.
(Der zweite Teil sowie einige Literaturhinweise sollen, so der Herr will, im nächsten Heft veröffentlicht werden.)
Kommentare
Verwandte Artikel
Nützliche Links
Elberfelder Übersetzung

Die Elberfelder Übersetzung Edition CSV ist eine wortgetreue Übersetzung der Bibel in verständlicher Sprache. Auf dieser Webseite können Sie den Bibeltext vollständig lesen und durchsuchen. Zudem werden Werkzeuge angeboten, die für das Studium des Grundtextes hilfreich sind.
www.csv-bibel.deDer beste Freund

Diese Monatszeitschrift für Kinder hat viel zu bieten: Spannende Kurzgeschichten, interessante Berichte aus anderen Ländern, vieles aus der Bibel, Rätselseiten, Ausmalbilder, Bibelkurs, ansprechende Gestaltung. Da Der beste Freund die gute Nachricht von Jesus Christus immer wieder ins Blickfeld rückt, ist dieses Heft auch sehr gut zum Verteilen geeignet.
www.derbestefreund.deIm Glauben leben

Diese Monatszeitschrift wendet sich an alle, die ihr Glaubensleben auf ein gutes Fundament stützen möchten. Dieses Fundament ist die Bibel, das Wort Gottes. Deshalb sollen alle Artikel dieser Zeitschrift zur Bibel und zu einem Leben mit unserem Retter und Herrn Jesus Christus hinführen.
Viele Artikel zu unterschiedlichen Themen - aber immer mit einem Bezug zur Bibel.
www.imglaubenleben.de